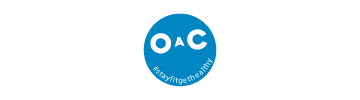Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Pathologischer Befund bei Prostatakrebs
18. Juni 2025 | von Ingrid Müller - aktualisiert und medizinisch geprüftDer pathologische Befund ist eine Art „Steckbrief“ des Prostatatumors, der nach einer Gewebeuntersuchung im Labor erstellt wird. Im Video erfahren Sie zudem, was ein Pathologe sieht und welche Schlüsse er daraus ziehen kann.
Der pathologische Befund ist ein Dokument, in dem die Ergebnisse einer Gewebeuntersuchung zusammengefasst sind. Das Wort „pathologisch“ bedeutet „krankhaft“. Bei Prostatakrebs kann dieses Gewebe kann zum Beispiel im Rahmen einer Biopsie oder Prostata-Operation entnommen worden sein. Ein Pathologe oder eine Pathologin erstellt den pathologischen Befund. Er zeigt, ob es sich um Prostatakrebs handelt oder die Zellen im Gewebe vielleicht doch gutartig sind.
Wenn Prostatakrebszellen unter dem Mikroskop nachgewiesen wurden, lässt sich die Art des Prostatakarzinoms, das Stadium, die Aggressivität und besondere Merkmale der Tumorzellen feststellen. Vergleichbar ist der pathologische Befund mit einem „Steckbrief“ oder „Fingerabdruck“ des Tumors. Für behandelnde Ärztinnen, Ärzte und betroffene Männer ist er von entscheidender Bedeutung, weil er die Krebsbehandlung beeinflusst. Wichtig ist, dass Expertinnen und Experten aus der Pathologie und Urologie Rücksprache halten und gut miteinander abstimmen.
YouTube inaktiv
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann dieses Modul nicht geladen werden. |
|---|
Pathologischen Befund erstellen
Bis der Befund aus der Pathologie vorliegt, dauert es meist zwei bis vier Werktage. Der Befund wird in verschiedenen Schritten erstellt. Zuerst wird das Gewebe analysiert, das aus dem verdächtigen Bereich der Prostata entnommen wurde, etwa durch eine Stanzbiopsie. Auch Gewebe, das im Rahmen einer Operation (radikale Prostatektomie) entnommen wurde, wird im Labor untersucht.
Pathologinnen und Pathologen fixieren und konservieren das entnommene Gewebe zunächst in Formalin. Danach wird es in dünne Scheiben geschnitten, mit einem Farbstoff angefärbt und unter dem Mikroskop auf verschiedene Eigenschaften und Merkmale untersucht – die wichtigsten sind:
- Zytologie: Wie sehen die Zellen aus? Wie sehr ähneln sie noch gesunden Zellen („Grading“)?
- Histologie: Wie ist die Architektur des entnommenen Gewebes?
- Atypien: Gibt es Abweichungen bei den Zellkernen oder bei den Muster der Zellteilung?
- Wachsen die Krebszellen unter dem Einfluss von Hormonen? Dann liegt ein hormonempfindlicher Prostatakrebs vor. Die Zellen besitzen vermehrte Bindungsstellen (Rezeptoren) für Androgene.
- In welchem Stadium befindet sich der Prostatakrebs? Untersucht wird, ob und inwieweit Krebszellen in umliegendes Gewebe, Lymphknoten oder weiter entfernte Organe eingedrungen sind. Danach wird der Prostatakrebs als lokal begrenzt, lokal fortgeschritten oder metastasiert eingestuft. Bestimmt wird unter anderem das TNM-Stadium (Tumorgröße, Lymphknotenbefall, Metastasen). „Staging“ heißt dieses Vorgehen
- Wie aggressiv ist der Tumor? Dies zeigt der Gleason-Score.
Pathologischen Befund verstehen
Den pathologischen Befund besprechen Fachleute verschiedener Fachrichtungen in einem Tumorboard oder einer Tumorkonferenz. Dieses interdisziplinäre Gremium setzt sich zum Beispiel aus Fachleuten aus der Onkologie, Pathologie, Chirurgie oder Radiologie zusammen. Sie diskutieren sie die Ergebnisse und überlegen für Sie individuell die bestmögliche Prostatakrebstherapie.
Das Ergebnis des Befundes erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch. Den pathologischen Befund erhalten Sie in schriftlicher Form. Er enthält viele Informationen zu Ihrer Erkrankungen in Form von Fachbegriffen und Abkürzungen. Für Ärztinnen und Ärzte sind diese verständlich, aber meist nicht für medizinische Laien. Fragen Sie deshalb immer nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.
Diagnose: Welche Erkrankung?
Die Diagnose bei einer Untersuchung von Prostatagewebe kann unterschiedlich lauten. Es kann sich zum Beispiel um Vorstufen von Prostatakrebs handeln (prostatische intraepitheliale Neoplasie = PIN), eine gutartige Veränderung, aber auch um Prostatakrebs.
- Prostatakrebs (Prostatakarzinom, Prostata-Ca), wenn bei der pathologischen Analyse Prostatakrebszellen nachgewiesen wurden. Der Krebs bekommt einen Namen, meist Adenokarzinom. Dies ist ein Tumor, der vom Drüsengewebe der Prostata ausgeht.
- Gutartige Prostataveränderung (z.B. Prostatavergrößerung, Prostataentzündung), wenn im Gewebe keine Krebszellen gefunden wurden.
Grading
Das Grading beschreibt, wie ähnlich die Krebszellen gesunden Zellen noch sind. Fachleute sagen dazu, wie gut sie differenziert sind.
- G1: Gut differenziert – die Zellen ähneln normalem Gewebe, der Tumor wächst langsam
- G2: Mäßig differenziert – das Wachstum ist mittelschnell
- G3/G4: Schlecht differenziert oder undifferenziert – der Tumor ist aggressiv und wächst schnell
Stadium
Die TNM-Klassifikation ist ein internationaler Standard, um die Ausdehnung von Tumoren zu beschreiben.
- T (Tumor): Wie groß ist der Tumor und wie weit hat er sich ausgebreitet? Es gibt T1 bis T4; je höher die Zahl, desto weiter ausgedehnt ist auch der Tumor
- N (engl. node): Sind Krebszellen in die Lymphknoten eingewandert? NO bedeutet, dass keine Krebszellen nachweisbar sind. Bei N1, N2 und N3 sind mehrere Lymphknoten befallen.
- M (Metastasen): Gibt es Fernmetastasen in weiter entfernten Geweben und Organen? Bei Prostatakrebs bilden sie sich vor allem in den Knochen, aber auch in der Leber oder Lunge. M0 bedeutet, dass keine Fernmetastasen nachweisbar sind. M1 heißt, dass Metastasen gefunden wurden.
Aus diesen Daten wird eine Tumorformel erstellt. Manchmal wird der Formel TNM noch ein kleines „p“ vorangestellt. Dies bedeutet, dass eine Gewebeprobe nach der Operation untersucht wurde.
Prostatakarzinome lassen sich auch nach der UICC-Klassifikation einteilen:
| Stadium | Beschreibung |
|---|---|
| T1-2 N0 M0 | lokal begrenzter Prostatakrebs |
| T3-4 N0 M0 | lokal fortgeschrittene Prostatakarzinom |
| N1 und/oder M1 | regional beziehungsweise fernmetastasiertes Prostatakarzinom |
Daneben existieren noch einige weitere Klassifikationen, zum Beispiel des National Comprehensive Cancer Network (NCCN) oder der European Association of Urology (EAU). Pathologen und Pathologinnen sollten daher angeben, nach welchem System sie ein Prostatakarzinom klassifiziert haben.
Resektionsstatus
Die R-Klassifikation beschreibt, ob der Tumor im Rahmen der Operation vollständig (im Gesunden) entfernt wurde. Ärztinnen und Ärzte schneiden einen Tumor mit einem gewissen Sicherheitsabstand heraus. Bei der Analyse des Gewebes achten Fachleute darauf, ob sich an den Tumorrändern noch Krebszellen befinden oder ob sie frei von Tumorzellen sind. Manchmal müssen sie erneut operieren.
| Resektionsstatus | Beschreibung |
|---|---|
| R0 | Keine Krebszellen an den Rändern vorhanden – vollständige Entfernung (Resektion) des Tumor |
| R1 | Mikroskopischer Resttumor vorhanden |
| R2 | Makroskopischer Resttumor sichtbar |
Lymph- und Blutgefäße
- Lymphgefäßinvasion (L-Status): Der Prostatakrebs könnte über das Lymphsystem gestreut haben. Bei L0 ist dies nicht der Fall, bei L1 sind dagegen Krebszellen im Lymphsystem nachweisbar.
- Gefäßinvasion (V-Status): Befinden sich Krebszellen in Blutgefäßen? Bei V0 ist dies nicht der Fall, bei V1 dagegen schon. Dies bedeutet ein erhöhtes Risiko für Metastasen.
Molekularbiologische und genetische Merkmale
Bei manchen Krebsarten spielen inzwischen biologische und molekulargenetische Marker eine Rolle. In manchen Fällen kann die Bestimmung für die Therapieplanung wichtig sein. Denn: Es gibt neue Therapien, die sich gegen spezielle Merkmale richten. Manche Marker werden aber nur in besonderen Fällen und nicht routinemäßig bestimmt.
Einige Beispiele:
- Ki-67-Wert: Dies ist ein sogenannter Proliferationsmarker. Er zeigt, wie viele Zellen sich in der Teilungsphase befinden und lässt Rückschlüsse auf die Wachstumsgeschwindigkeit eines Tumors zu. Ein hoher Ki-67-Wert bedeutet eine schnellere Zellteilung und ein aggressiveres Tumorwachstum.
- PD-L1: Die Abkürzung steht für Englisch „Programmed-Death-Ligand 1“. Das ist ein Eiweiß, das eine wichtige Rolle im Immunsystem spielt. Krebszellen können es übermäßig ausbilden und so die Immunantwort unterdrücken. Für die Immunabwehr sind sie „unsichtbar“. Die Immuntherapie mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren greift an diesem Merkmal an. Die Medikamente heben diese Blockade auf. Dann kann das Immunsystem die Krebszellen wieder erkennen, angreifen und zerstören.
- Mismatch Repair (MMR)-Proteine: Sie sind für „Reparaturarbeiten“ der Zellen zuständig. Funktionieren die MMR-Proteine nicht richtig, liegt eine Mismatch Repair (MMR)-Defizienz vor. Sie wird auch als dMMR abgekürzt. Dann könnten Immun-Checkpoint-Inhibitoren eine Behandlungsmöglichkeit sein.
- BRCA-Mutation: Eine Veränderung (Mutation) in einem der Brustkrebsgene BRCA1 oder BRCA2 kann auch Männer betreffen. Sie kann von Geburt an in der Keimbahn (Samenzellen). Diese Männer haben ein erhöhtes Risiko für verschiedene Krebsarten, auch für Prostatakrebs. Eine BRCA-Mutation kann aber auch im Lauf des Lebens erworben sein. Diese somatische Mutation befindet sich in den Körperzellen. Bei einer BRCA-Mutation könnten bestimmte Medikamente in Frage kommen, sogenannte PARP-Hemmer. Sie verhindern, dass schwere Erbgutschäden repariert werden und sorgen dafür, dass die Krebszellen absterben.
Was bedeutet der pathologische Befund für die Therapie?
Der pathologische Befund bei Prostatakrebs bestimmt, welche Therapien Ärztinnen und Ärzte Ihnen vorschlagen. Bei Prostatakrebs gibt es viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die meist in Kombination eingesetzt werden, um mehr Schlagkraft zu entfalten. Sie reichen von der aktiven Überwachung, Operation (radikale Prostatektomie) und fokalen Therapien bis hin zur Strahlentherapie von außen oder von innen (Brachytherapie), Hormontherapie und Chemotherapie.
Quellen:
|