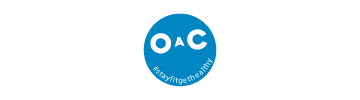Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Rückfall bei Prostatakrebs: PSA-Rezidiv erkennen und behandeln
24. November 2025 | von Ingrid Müller - Chefredakteurin, aktualisiert und medizinisch geprüftManchmal kehrt Prostatakrebs trotz einer Prostata-OP oder Bestrahlung zurück. Lesen Sie, was ein steigender PSA-Wert bedeutet und wie sich ein PSA-Rezidiv erkennen und behandeln lässt.
Kurzüberblick
|
Was ist ein PSA-Rezidiv?
Ein PSA-Rezidiv bedeutet, dass der PSA-Wert nach einer Krebsbehandlung wie der Operation (radikale Prostatektomie) oder Strahlentherapie wieder ansteigt. Normalerweise fällt der PSA-Wert einige Wochen nach dem chirurgischen Eingriff in einen Bereich ab, in dem er nicht mehr nachweisbar ist. Dies gilt als Anzeichen dafür, dass der bösartige Tumor vollständig entfernt wurde. Auch nach einer Strahlentherapie sinkt der PSA-Wert in einen niedrigen Bereich. Dies zeigt an, dass die Bestrahlung erfolgreich war.
Erhöht sich der PSA-Wert nach der Entfernung der Prostata oder der Bestrahlung wieder, besteht der Verdacht, dass der Prostatakrebs zurückgekehrt ist und der Tumor wieder wächst. Der medizinische Fachausdruck für einen solchen Rückfall ist Rezidiv. Ärztinnen und Ärzte kontrollieren den PSA-Wert regelmäßig im Rahmen der Nachsorge, um ein Wiederaufflammen des Prostatakrebses so früh wie möglich zu erkennen. Deshalb sind regelmäßige Nachsorgetermine auch so wichtig.
PSA-Werte richtig lesen Alles über freies und gebundenes PSA, die PSA-Anstiegsgeschwindigkeit, PSA-Verdoppelungszeit und PSA-Dichte. |  |
|---|
PSA-Rezidiv: Diagnose
Prostatakrebs kann zurückkehren, obwohl Sie keine Symptome und Beschwerden verspüren. Medizinerinnen und Mediziner sprechen von einem biochemischen Rezidiv, PSA-Rezidiv oder PSA-Progress, weil allein der erhöhte PSA-Wert auf den Rückfall hinweist.
Zur Diagnose eines Rezidivs bestimmen Ärztinnen und Ärzte das prostataspezifische Antigen (PSA) mindestens zweimal nacheinander. Folgende Werte liefern Hinweise auf ein Rezidiv:
- Nach Prostata-Operation: Beträgt der PSA-Wert beide Male nach einer Operation mehr als 0,2 Nanogramm/Milliliter (ng/ml), liegt aller Wahrscheinlichkeit nach ein Rezidiv vor. Eine Biopsie ist in diesem Fall nicht nötig, um die Diagnose zu sichern.
- Nach Bestrahlung: Ein PSA-Rezidiv kann auch vorliegen, wenn der PSA-Wert nach einer alleinigen Strahlentherapie in mindestens zwei Messungen mehr als 2 ng/ml über dem tiefsten gemessenen Wert – dem Nadir – liegt. Eine Biopsie, um das biochemische Rezidiv zu sichern, ist empfohlen, wenn das Rezidiv örtlich behandelt werden soll.
Örtlicher Rückfall oder Metastasen?
Bei einem PSA-Rezidiv gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder ist der Prostatakrebs örtlich im vorherigen Operations- oder Bestrahlungsgebiet der Prostata zurückgekehrt (Lokalrezidiv). Die Krebszellen können sich aber auch auf Wanderschaft begeben und über die Blut- und Lymphbahnen ausgebreitet haben. Sie können Tochtergeschwülste in anderen Organen bilden (Metastasen oder Fernmetastasen). Man spricht auch von einem systemischen Rezidiv. Bei Prostatakrebs entwickeln sich Metastasen oft zuerst in den Knochen, aber auch in der Leber oder Lunge.
Um zwischen einem Lokalrezidiv und Fernmetastasen zu unterscheiden, ziehen Ärztinnen und Ärzte verschiedene Parameter heran:
- PSA-Verdopplungszeit – wie schnell steigt der PSA-Wert an?
- Latenzzeit zu den Ersttherapien - wie lange liegt die Operation oder die Bestrahlung schon zurück?
- Gleason-Score – wie aggressiv waren die Krebszellen beim ursprünglichen Tumor?
Allgemein gilt: Je schneller sich der PSA-Wert verdoppelt, je früher das Rezidiv auftritt (je kürzer die Zeitspanne zu den Ersttherapien) und je höher der Gleason-Score des ersten Prostatakarzinoms war, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Metastasen. Davon hängen die weiteren Krebstherapien ab.
Auch bildgebende Verfahren können bei der Diagnose eines PSA-Rezidivs weiterhelfen. Die PSMA-PET/CT ist bei einem Rezidiv nach einer Prostatektomie oder Strahlentherapie einsetzbar, um die Ausbreitung des Tumors zu beurteilen, wenn das Untersuchungsergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf die Therapiewahl hat. Die PSMA-PET/CT kann schon bei sehr niedrigen PSA-Werten Anhaltspunkte dafür liefern, ob ein Lokalrezidiv vorliegt oder sich Metastasen gebildet haben.
Auch die Knochenszintigrafie kommt in manchen Fällen zum Einsatz, um Knochenmetastasen aufzuspüren oder auszuschließen. Von den Untersuchungsergebnissen hängt es ab, welche Therapien Ihr Behandlungsteam jetzt vorschlägt. Denn ein Lokalrezidiv wird anders behandelt als Metastasen, zum Beispiel in den Knochen.
Manchmal liefert die Bildgebung zwar negative Ergebnisse, aber es gibt dennoch Anhaltspunkte, die für ein Lokalrezidiv sprechen. Dann beginnen Ärzte und Ärztinnen meist gleich mit der Behandlung und warten die weitere Entwicklung nicht erst ab.
Die Autorinnen und Autoren stufen das biochemische Rezidiv nach seinem Risiko ein. Die Grundlage ist die Einteilung der European Association of Urology (EAU).
| Niedriges Risiko | Hohes Risiko | |
|---|---|---|
| Nach radikaler Prostatektomie |
UND
|
ODER
|
| Nach Strahlentherapie |
UND
|
ODER
|
PSA-Rezidiv: Behandlungen
In manchen Fällen ist die Ausgangssituation günstig und der PSA-Wert nimmt nach einer Operation oder Bestrahlung über Jahre hinweg zu, ohne dass Sie Beschwerden entwickeln. Dann kann das Abwarten eine Strategie sein. In folgenden Fällen können Ärzte und Ärztinnen das PSA-Rezidiv zunächst nur beobachten:
- Der PSA-Wert steigt nur langsam an – die Verdopplungszeit des PSA-Wertes beträgt mehr als zwölf Monate.
- Der Gleason-Score liegt unter 8 (ISUP <4) – er lässt Aussagen über die Aggressivität des ersten Prostatatumors zu
Bei der Entscheidung – abwarten oder behandeln – spielen auch Ihr allgemeiner Gesundheitszustand, Ihr Alter und auch Ihre persönlichen Wünsche mit. Sprechen Sie immer ausführlich mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin. Wägen Sie gemeinsam alle Vor- und Nachteile ab – erst dann entscheiden Sie.
Die Wahl der Behandlung richtet sich danach, ob das PSA-Rezidiv lokal vor Ort auftritt oder ob sich Metatastasen in anderen Organen gebildet haben. Auch vorausgegangene Krebstherapien, etwa die Prostata-OP oder eine Strahlentherapie, spielen für die Therapiewahl bei einem Rezidiv eine Rolle.
Lokalrezidiv nach radikaler Prostatektomie behandeln
Ein Lokalrezidiv nach einer Operation – der radikalen Prostatektomie - lässt sich mit einer Strahlentherapie behandeln, bei der Radiologen und Radiologinnen die betroffene Region von außen bestrahlen. Diese Art der Bestrahlung heißt auch Salvage-Strahlentherapie (engl. salvage = Rettung), Salvage-Radiotherapie oder nachgeschaltete Bestrahlung. So lässt sich das Rezidiv in der Umgebung des Operationsgebietes oft noch heilen. Die Bestrahlung sollte möglichst frühzeitig beginnen.
Ist das Risiko hoch, dass das Rezidiv weiter fortschreitet, sollten Ärzte und Ärztinnen zusätzlich zur Salvage-Strahlentherapie eine Hormonentzugstherapie oder den Wirkstoff Bicalutamid (ein Antiandrogen) anbieten. Die Dauer der zusätzlichen Hormontherapie hängt vom Risiko für das Fortschreiten des Tumors ab (Progressionsrisiko). Sie kann zwischen 6 und 24 Monaten betragen.
Auch eine Kältetherapie (Kryotherapie), Brachytherapie oder die Behandlung mittels hochintensiviertem fokussiertem Ultraschall (HIFU) könnten laut der EAU-Leitlinie Möglichkeiten sein, wenn eine Salvage-Prostatektomie nicht möglich ist. Die HIFU besitzt jedoch experimentellen Charakter.
Angst vor dem Rezidiv? Lesen Sie, mit welchen Strategien sich die Angst vor einer Rückkehr des Prostatakarzinoms bannen lässt. |  |
|---|
Lokalrezidiv nach Strahlentherapie behandeln
Bei einem Lokalrezidiv nach einer Strahlenbehandlung (perkutan über die Haut oder Brachytherapie) kommt die Operation in Form einer radikalen Prostatektomie in Frage. Sie heißt “Salvage-Prostatektomie”. Vorher ist eine Biopsie empfohlen. Die Salvage-Prostatektomie sollte nur erfahrene Ärzte und Ärztinnen durchführen, weil zuvor bestrahltes Gewebe schwieriger zu operieren ist. Zu beachten ist auch, dass die Spätfolgen dieser OP oft einschneidender ausfallen als wenn Chirurgen und Chirurginnen den Prostatakrebs zuerst operieren. Besonders häufig kommen Erektile Dysfunktion und Inkontinenz vor.
Zudem kann die HIFU ist eine Behandlungsmöglichkeit für ein Lokalrezidiv sein, das sich nach einer Bestrahlung gebildet hat. Wichtig ist, dass die HIFU hier eine experimentelle Therapie ist.
Metastasen: Behandlung
Bei einem metastasierten hormonempfindlichen Prostatakarzinom (mHSPC) ist die Hormontherapie eine wichtige Strategie, um die Tochtergeschwulste in Schach zu halten und ihre weitere Ausbreitung zu verhindern. Sie sollte zeitnah nach der Diagnose beginnen. Im Gegensatz zu OP und Bestrahlung wird die Hormontherapie nicht nur örtlich, sondern im gesamten Körper (systemisch).
Auch kann die Hormonbehandlung das Auftreten von Beschwerden hinauszögern oder Symptome lindern, die durch die Metastasen entstehen können. Dazu gehören zum Beispiel Knochenbrüche, Knochenschmerzen, eine Kompression des Rückenmarks oder Verengungen der Harnleiter. Eine Heilung des PSA-Rezidivs gelingt jedoch in den meisten Fällen nicht.
Die Hormontherapie lässt sich mit verschiedenen Medikamenten durchführen, zum Beispiel:
- Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)-Agonisten – als Injektionen unter die Haut oder in den Muskel.
- GnRH-Antagonisten – als Injektionen unter die Haut oder oral als Tabletten.
- Bei Schmerzen oder drohenden Komplikationen kann zusätzlich ein Androgenrezeptor-Antagonist wie Apalutamid, Enzalutamid oder Darolutamid eingesetzt werden.
In der Regel werden mehrere Medikamente miteinander kombiniert. Welche Medikamente zum Einsatz kommen, hängt auch von Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand ab. Wichtig ist, dass Sie sich gut über sämtliche Behandlungsmöglichkeiten informieren und Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin alle Fragen stellen, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Dann entscheiden Sie gemeinsam über die richtige Behandlungsstrategie nach dem Prinzip der gemeinsamen Entscheidungsfindung (Shared Decision Making). Sie können sich auch jederzeit eine Zweitmeinung zu den Therapievorschlägen einholen, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
FAQs: Rezidiv bei Prostatakrebs
Es lässt sich nicht allgemein sagen, wie lange Sie mit einem Prostatakrebs-Rezidiv leben können. Eine Rolle für das Überleben spielt es, ob es sich um ein örtliches Rezidiv oder um Fernmetastasen handelt. Auch die Zeitspanne, wann das Rezidiv nach der Operation oder Strahlentherapie auftritt ist ein wichtiger Faktor, genauso wie der Gleason-Score, also die Aggressivität der Krebszellen. Mit Medikamenten oder einer erneuten Operation beziehungsweise Bestrahlung lässt sich das Krebswachstum aber bremsen und die Lebenszeit verlängern. Wie hoch ist die Rückfallquote bei Prostatakrebs? Die Rückfallquote bei Prostatakrebs lässt sich nur ungefähr beziffern. Bei etwa drei von zehn Männern wächst nach einer Prostatakrebs-Behandlung im Laufe der nächsten Jahre ein erneuter Tumor. Der Krebs kann entweder am Ort der Operation oder Bestrahlung (lokales Rezidiv) oder in weiter entfernten Körperregionen als Fernmetastasen wiederkehren. Besonders oft sind die Knochen betroffen. Wie schnell entwickelt sich ein Rezidiv? Ein Rezidiv kann sich unterschiedlich schnell entwickeln. Manchmal vergehen nach der ersten Behandlung wie einer Operation oder Strahlentherapie mehrere Monate, manchmal auch einige Jahre. Die Rezidivgefahr hängt von mehreren Faktoren ab, zum Beispiel vom Stadium des Tumors und der Aggressivität der Krebszellen. Was kann man bei einem Prostatakrebs-Rezidiv tun? Bei einem Prostatakrebs-Rezidiv kann man zwischen mehreren Behandlungsmöglichkeiten wählen. Welche Therapie in Frage kommt, hängt davon ab, welche Behandlungen Sie zuerst erhalten haben, wie aggressiv der Tumor ist und ob es sich um ein Lokalrezidiv oder Metastasen handelt. Auch Ihr Alter, Ihr Gesundheitszustand und Ihre Wünsche spielen in die Therapiewahl mit hinein. |
Quellen:
|